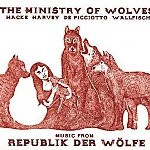 Am 15.02. dieses Jahres wurde im Schauspiel Dortmund erstmals das Stück „Republik der Wölfe“ aufgeführt, eine opulente Adaption bekannter Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm, oder genauer eine Adaption zweiten Grades, denn die Ideen und Texte basieren v.a. auf der lyrischen Neubearbeitung der Autorin Anne Sexton. Regisseurin Claudia Bauer arbeitet bei der Produktion eng mit dem musikalischen Leiter des Theaters, Paul Wallfisch, zusammen, und in den bisherigen Besprechungen ist neben Sexcrime und Splatter immer auch von der Musik die Rede. Wallfisch, selbst ein umtriebiger Pianist, rekrutierte für das Stück drei weitere Hochkaräter, namentlich Danielle de Picciotto, Alexander Hacke und Mick Harvey, deren Score nun auch als Album vorliegt.
Am 15.02. dieses Jahres wurde im Schauspiel Dortmund erstmals das Stück „Republik der Wölfe“ aufgeführt, eine opulente Adaption bekannter Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm, oder genauer eine Adaption zweiten Grades, denn die Ideen und Texte basieren v.a. auf der lyrischen Neubearbeitung der Autorin Anne Sexton. Regisseurin Claudia Bauer arbeitet bei der Produktion eng mit dem musikalischen Leiter des Theaters, Paul Wallfisch, zusammen, und in den bisherigen Besprechungen ist neben Sexcrime und Splatter immer auch von der Musik die Rede. Wallfisch, selbst ein umtriebiger Pianist, rekrutierte für das Stück drei weitere Hochkaräter, namentlich Danielle de Picciotto, Alexander Hacke und Mick Harvey, deren Score nun auch als Album vorliegt.
Die Musik zur „Republik der Wölfe“ ist ein reines Songalbum, irgendwo zwischen Rock, Cabaret und folkiger Songwritermusik angesiedelt, und wenn man es nicht wüsste, würde man ihr die Funktion als Bühnebegleitung kaum anmerken. Schon früh macht sich v.a. in den Texten bemerkbar, dass die Auswahl und Bearbeitung der Stoffe einem inhaltlich kohärenten Konzept folgt. Jede der Erzählungen wurde auf Bezüge zur Gegenwart, zur Politik und Kultur unserer Zeit und ihren typischen Ängsten und Begierden hin abgeklopft. Der rote Faden, auch wenn er sich erst nach und nach offen zeigt, ist der Bezug zum Wolfsmotiv, das schon durch die Titelwahl eine Brücke zu einem anderen europäischen Klassiker schlägt, nämlich Hobbes’ Essay „Leviathan“, in dem der Autor das Wesen der Menschen in der Allegorie des Wolfs verdichtete und mit dieser räuberischen Gesellschaftsidee eine der fatalen Grundmythen der Moderne schuf.
Der Bezug zur Gegenwart gelingt auch deshalb, weil die einzelnen Musiker, die ansonsten entweder mit Soloarbeiten oder mit Bands (Botanica, Einstürzende Neubauten, Crime and the City Solution etc.) aktiv sind, über weite Strecken in ihrer jeweils gewohnten Weise musizieren, wobei jeder der vier Stimmen ein bestimmter Stil zugeordnet ist. In der Zusammenstellung harmoniert dies prächtig und gibt zugleich ein Exempel ab für das heutige Songwriting, das in vielfältigen Traditionen steht und zahllose Zitate und Bezüge auf den Schultern trägt. Nicht jedem gelingt es, mit diesen Dingen, die auch eine Bürde sein können, so elegant zu jonglieren wie Wallfisch und Band. An vielen Stellen hört man aus diversen Rock- und Popkontexten vertraute Gesten oder meint das Echo bekannter, längst ikonisierter Stimmen zu hören.
Auf ihre je eigene Art sind alle Beiträge hier einer Ästehtik des Schönen verpflichtet, was mit den morbiden und nicht selten provokanten Inhalten nach Art klassischer Murder Ballads Kontraste eingeht. De Picciotto, die mit ihrem mädchenhaften Fantasysopran u.a. den Auftakt und das Schlussstück intoniert, hat für ihre Beiträge einen ambienten Dreampop gewählt, der mit seiner staubigen Dachkammeratmosphäre und dem verhuschten Glockenspiel die düstere Spannung der Texte (u.a. „Cinderella“, „Sleaping Beauty“) noch am direktesten einfängt. Die von Wallfisch gesungenen Stücke haben am meisten Rock’n'Roll im Blut und nähern sich den Geschichten auf eine eher cool-nonchalante Art, was wohl auch von Nöten ist, wenn man die Geschichte von Rapunzel mit der Tänzerin Isidora Duncan in Bezug setzt – statt langer Haare hatte die einen damals modischen Langschal, der ihr bekanntlich zum Verhängnis wurde. Mit gut plazierten Twangs und Honkytonk-Piano durchweht Wallfischs Beiträge stets der Hauch eines hartgesottenen, schwermütigen Blues.
Man könnte die von Mick Harvey gesungenen Stücke als den geerdetsten, bodeständigsten Part bezeichnen, was ihn nicht davon abhält, mit „The Frog Prince“ einen fulminanten Folkohrwurm beizusteuern. Alexander Hacke, der einzige der Neubauten ohne Pseudonym und habituell recht gut im Kreis um Simon Bonney aufgehoben, zeigt sich am expressivsten und zudem stimmlich wandlungsfähig. Bei „Snow White“ – unter anderem eine Hommage an die Zahl der Himmel, Sünden, Siegel, Weltwunder und Schöpfungstage – fällt es schwer, nicht an den Kanadier zu denken, den die Pogues einmal als „dear old Times Square’s favourite bard“ besangen.
Am Ende, nach einer knappen Stunde mit Bluesakkorden und Walzertakt, Rockklischees und berührenden Melodien, mag mitunter ein zwiespältiger Eindruck haften bleiben – zwiespältig deswegen, weil die Republik der Wölfe, trotz der inhaltlichen Drastik im Schnitt doch ein schöner Ort ist, an dem man gerne verweilt. Ein Ort, an dem Spannung und heimelig-unheimliches Zwielicht herrscht und die hässlichsten Dinge, Ramsch und Langeweile, konsequent fehlen. Man muss schon die lebenswichtigen Betriebsblindheiten unserer Zeit perfekt verinnerlicht haben, um diesen Bruch nicht zu bemerken, der sicher noch deutlicher aufscheinen würde, hätten die vier Wölfe hier ein glattes, kitschiges und durchweg schönfärberisches Szenario geschaffen. Dieser Zwiespalt trägt zum Großteil zum Reiz des Albums bei, und wenn auch auf der Bühne davon noch etwas zu spüren sein sollte, dann wäre dem Fantasydrama ein großes Stück Realismus gelungen. (U.S.)
Label: Mute
