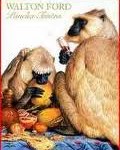 Der aus Neu-England stammende Künstler Walton Ford ist einer der wenigen gegenwärtigen Tiermaler, die den Sprung aus den Naturkundemuseen in die “Welt der Kunst” geschafft haben – wobei man gleich zu Beginn auf die Unsinnigkeit dieser Gegenüberstellung verweisen muss, denn Kunst mit den Gewohnheiten des Feuilletons und dem gängigen kunsthistorischen Lehrprogramm gleichzusetzen, kann nur auf einfallslosen Vorstellungen beruhen. Nach zahlreichen kleineren Ausstellungen in internationalen Galerien wurde der eigenwillige Maler, der lebensgroße Tiere gerne im Zustand der Gewalt und Agonie präsentiert, nun auch in der deutschen Museumslandschaft geadelt: Das Museum „Hamburger Bahnhof“, die Berliner Heimat von postmodernen Größen wie Warhol, Rauschenberg, Beuys und Twombly, veranstaltete unlängst eine Einzelausstellung seiner Werke. Im Zuge dessen entstand auch sein Bildband „Pancha Tantra“, der über hundert seiner Gemälde der letzten Jahre enthält.
Der aus Neu-England stammende Künstler Walton Ford ist einer der wenigen gegenwärtigen Tiermaler, die den Sprung aus den Naturkundemuseen in die “Welt der Kunst” geschafft haben – wobei man gleich zu Beginn auf die Unsinnigkeit dieser Gegenüberstellung verweisen muss, denn Kunst mit den Gewohnheiten des Feuilletons und dem gängigen kunsthistorischen Lehrprogramm gleichzusetzen, kann nur auf einfallslosen Vorstellungen beruhen. Nach zahlreichen kleineren Ausstellungen in internationalen Galerien wurde der eigenwillige Maler, der lebensgroße Tiere gerne im Zustand der Gewalt und Agonie präsentiert, nun auch in der deutschen Museumslandschaft geadelt: Das Museum „Hamburger Bahnhof“, die Berliner Heimat von postmodernen Größen wie Warhol, Rauschenberg, Beuys und Twombly, veranstaltete unlängst eine Einzelausstellung seiner Werke. Im Zuge dessen entstand auch sein Bildband „Pancha Tantra“, der über hundert seiner Gemälde der letzten Jahre enthält.
Was ist das Besondere an Fords mit Gouache und Tinte verfeinerten großflächigen Tieraquarellen? An Medien und Motiven, an denen sich vor und parallel zu ihm bereits unzählige andere Künstler versucht haben? Wirft man einen ersten Blick auf seine farbenprächtigen Szenerien, so erinnern sie einen zunächst an Illustrationen aus Naturkundebüchern des 18. Jahrhunderts, und man könnte zu dem vorschnellen Ergebnis gelangen, die detailrealistischen Bilder seinen zwar schön, ihre Besonderheit läge jedoch einzig in ihrem exotischen Status innerhalb der zeitgenössischen Kunstmuseen- und Galerienlandschaft begründet. Dass dem keineswegs so ist wird einem meist schon auf den zweiten oder dritten Blick gewahr, denn die Bilder zeigen weder beschönigende, noch auch nur sachlich-deskriptive Tierszenarien, wie es in alten Illustrationen, die in der Tat zuallererst als Referenzen genannt werden müssen, beinahe ausschließlich der Fall war. In Fords Welt begegnet einem beispielsweise ein riesiger, mörderischer Gorilla, der nach dem Erschlagen eines Tierforschers im Siegestaumel dessen Flinte zerbricht. Ein weiterer Primat mit bösartigem Charaktergesicht, der einem Vogel seelenruhig den Hals umdreht, und ein enormer Polarbär, umgeben von den Resten eines menschlichen Skeletts. Tiere bei der Jagd, Tiere beim Töten und Krepieren. Eine Natur, die in all ihrer Pracht bar jeden Schmuseeffektes gezeigt wird, eine Natur eher im Sinne des Marquis de Sade statt in jenem einer trivialen Pseudoromantik. Ist es das, was uns der Maler näherbringen will – fragten einige Stimmen im Feuilleton – der darwin’sche Alptraum des ewigen Fressens und Gefressenwerdens, in dem Stärke triumphiert und das Schwache zum Material degradiert wird? Vielleicht, unter anderem, auch wenn das zugegebenermaßen etwas wenig wäre, und die künstlerische Aussage definitiv hinter die Schönheit der Sujets zurückfallen würde. Das Wissen über diese Seite der Natur ist bekannt, oder unterschätzt man da die Museumsbesucher? Und muss Kunst immer zwangsläufig etwas Neues bieten? Sicher nicht im Zeitalter der subtilen Variation, wie Herbert Grabes die Periode der späten Postmoderne in seiner „Ästhetik des Fremden“ charakterisierte.
Ließe sich eine solche Lesart zwar durch die Feststellung rechtfertigen, dass Natur generell im zeitgenössischen Kunstdiskurs einen eher marginalen Stand hat, muss man allerdings hinzufügen, dass es in Fords Bildern auch kaum ausschließlich um Natur geht. Dass die animalischen Leidens- und Gewalttableaus in der Machart des 18. Jahrhunderts selbstredend auch den Blick der damaligen Zeit reflektieren und kritisch hinterfragen, wurde zurecht festgestellt, und dass sie somit ebenso sehr um das Selbstverständnis der Menschenwelt als „zivilisiert“ kreisen. Dies zeigt sich zum einen in Fords obsessiver Lust am Übertreiben und Überzeichnen, was einigen Bildern beim genauen Hinsehen eine surreale, ja zum Teil beinahe ins Absurde tendierende Qualität verleiht. All dies wird zum anderen noch verstärkt durch kleine Texte, die der Künstler den jeweiligen Gemälden zugeordnet hat, und die zum Großteil Ausgangspunkt der einzelnen Tableaus waren: Briefe, Tagebucheintragungen, Abhandlungen und Memoiren von Entdeckern und anderen Zeitzeugen von der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert, die in Kontakt mit den als „exotisch“ verstandenen Spezies kamen, kommen zitatweise zu Wort. Da wird ein eher harmlos und etwas melancholisch dreinblickender Chimpanse in Ketten in den Aufzeichnungen des englischen Chronisten Samuel Pepys als „A Monster From Guinea“ bezeichnet, das vermutlich auf die sexuelle Verbindung eines Menschen mit einem Pavianweibchen zurückgeht, während das eigentlich Beängstigende im Bild eher eine brennende Stadt ist, die sich ganz klein am Bildrand mehr versteckt als zeigt – vom Menschen gelegte Feuer sind in Fords Werken kein seltenes Binnenmotiv. Der von Europa nach Amerika importierte Star (gemeint ist die Vogelart) wird zu einem bedrohlichen Eroberer und Landräuber stilisiert – im Originalbild ist der Vogel beinahe zwei Meter groß! Die Ausrottung des sogenannten Tasmanischen Tigers, eines eher hundeartigen Beuteltieres mit gestreiftem Rücken, wird mit Bezug auf die Gefräßigkeit des vermeintlichen Schafräubers im „Tasmanian Mail Supplement“ als segensreiche Arbeit glorifiziert. Der Schaden in den Schafherden ist ebensowenig belegt wie die Behauptung, das Tier habe Menschen angegriffen, mit der man die Auslöschung der Spezies zu rechtfertigen suchte. Ford setzt diesen Tieren in dem beeindruckenden Tryptichon „The Island“ ein Denkmal, in dem er sie schlicht als die Insel darstellt, von deren Oberfläche sie verschwinden mussten – als eine im Meer versinkende Insel, mit der auch all jene Klischees dem Vergessen anheimfallen, die sich um ihre Blutrünstigkeit ranken, bilden sie eines der apokalyptischsten Sujets des Künstlers.
Natürlich muss man allen, die behaupten, Ford zeige in seinen allegorischen Szenen nur die Projektionen früherer Tierdiskurse und persifliere die Vorstellung der bestialischen Natur lediglich, entgegenhalten, dass es kaum Anhaltspunkte in seinem Werk gibt, die darauf hinwiesen, es gäbe das Räuberische, Gefährliche in der Tierwelt nicht. Ford präsentiert die Natur keineswegs „nur“ als Diskurs. Man sieht immer die Überblendung von quasi naturkundlichem Realismus und dem Aufzeigen von Dämonisierung, und letztere lässt sich so umso mehr reflektieren und hinterfragen. Wenn der Gorilla den Naturforscher erschlagen hat, wer hat dann das Bild von ihm gezeichnet? Ist der Eisbär wirklich der Menschenfresser, als der er im beigefügten Text beschrieben wird? Auf der Abbildung spielt das Tier mit einem menschlichen Schädel, der durch seine Kahlheit eher wie der Überrest eines schon lange verhungerten oder erfrorenen Menschen wirkt – es ist kein Blut zu sehen, wie übrigens selten bei Ford. Zu offensichtlich wäre dem Ästheten die Derbheit zerfetzter Körper, Ford will auch seine sterbenden Tiere und Menschen erhaben, kraftvoll und schön präsentieren, und bleibt darin den klassizistischen Vorstellungen des immer als Subtext fungierenden Jahrhunderts der Aufklärungen treu. Das Leben wird gefeiert, es ist dramatisch, mitunter schmerzhaft, aber auf graphischer Ebene weitgehend frei vom Abjekt. Der Eingriff des Menschen in die Natur scheint Ford ein ebenso wichtiges Thema zu sein. Der Maler geht dabei auch mit den Tier-“Freunden“ früherer Epochen hart ins Gericht, wie Tierschaubetreiber oder Forscher. Letztere sind teilweise sogar Fords künstlerische Idole, wie der in Amerika noch heute beliebte John James Audubon, dessen „Birds of America“ im direkten Vergleich wie eine verniedlichende Vorstufe von Fords Bildern anmuten, eine heile Welt, von deren Kehrseite die von Ford gesammelten Begleittexte beredtes Zeugnis abgeben: Audubon schoss hunderte von Vögeln ab, um sie anschließend in der ästhetisch ansprechendsten (gestellten) Körperhaltung abmalen zu können. Ford dagegen wurde bereits als “Audubon on Viagra” betitelt, dessen Temperament einer verklemmten Doppelmoral wie der seines Vorläufers entgegenwirke. Doch wessen Doppelmoral steht hier eigentlich zur Diskussion – die des romantischen Tier-Nerds, der den gängigen Moralvorstellungen seiner Zeit entsprechend schlicht ein Exzentriker war, oder unsere, die wir uns vielleicht an seinen Bildern erfreuen, obwohl wir aus heutiger Tierethik heraus urteilen müssten, dass – pathetisch gesprochen – “Blut an ihnen klebt”? Auch diese Ambivalenz macht Ford zum Thema, indem er sich in die Tradition solcher Vorbilder und Quellen stellt, ihnen jenseits platter Dekorativität eine Brücke in die Jetztzeit baut, und sie gleichsam mal augenzwinkernd, mal offen sarkastisch persifliert. In Fords Darstellungen wird aber auch nicht nur die brutale Kehrseite präsentiert, auch die lustige Seite menschlicher Übergriffe hat Raum jenseits der Absurdität des Grausamen: Seine Darstellung von ernsthaft vorgenommenen Versuchen, Tiere zu Menschen zu erziehen, haben manch rührenden Zug.
Dass Walton Fords Ausstellungen gerne auch von Schulklassen besucht werden ist sicher nicht der einzige Zusammenhang, bei dem der doppelbödige Zug und die darstellerische Weite des Künstlers positiv auffällt – die differenzierte Doppelbödigkeit eines Malers, der die Tiere ohne Verniedlichung und Verharmlosung darstellt und dennoch bei allem Naturalismus ganz platt formuliert „auf deren Seite ist“. Der kulturkritischer Historiograph ist und gleichsam nostalgieverliebter ästhetizistischer Schöngeist mit Liebe zum Idyll (ein Spagat, für den er bereits als eine Art Noah Gordon der bildenden Kunst missverstanden wurde). In dem zuletzt bei Taschen erschienenen über 300seitigen Hardcover-Bildband, dessen Titel auf eine gleichnamige Tierfabel-Sammlung der klassischen indischen Literatur referiert, möchte man keines der abgedruckten Gemälde und ihre Detailansichten missen, wenngleich es bedauerlich ist, dass die Begleittexte lediglich im Anhang zu finden und somit aus dem Text-Bild-Zusammenhang gerissen sind. Aber weder dies noch die etwas kurz geratene dreisprachige essayistische Einleitung von Bill Buford vermögen den ästhetischen Genuss von Fords Bildern zu schmälern, denn die darin präsentierten Geschichten wirken schier unerschöpflich an schönen, skurrilen und morbiden Details. (U.S.)
