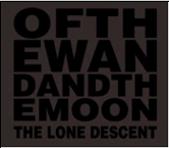 Vorschnelle Geister würden es vielleicht eine anthropologische Konstante nennen, oder aber ein Klischee aus der Küchenpsychologie: Man schätzt und begehrt, was unerreichbar scheint, was man aus der Ferne vernimmt, was stetig, und doch unauslöschlich in der Erinnerung vergilbt. Sehnsucht wird tausendfach verkitscht, und ist doch als realer Schmerz nicht totzukriegen. Doch das Abwesende ist nicht nur ein allgegenwärtiger Punkt, um den das Begehren des Menschen kreist, es ist auch ein Motiv, ohne das die schmachtendste Kunstform überhaupt, die Popmusik, vielleicht nicht einmal existieren würde. “Absence makes the heart grow fonder” hieß es bei Dean Martin und unzähligen Nachfolgern, ins Negative gewendet brachten die Fehlfarben auf den Punkt: “Was ich kriegen kann gefällt mir nicht”.
Vorschnelle Geister würden es vielleicht eine anthropologische Konstante nennen, oder aber ein Klischee aus der Küchenpsychologie: Man schätzt und begehrt, was unerreichbar scheint, was man aus der Ferne vernimmt, was stetig, und doch unauslöschlich in der Erinnerung vergilbt. Sehnsucht wird tausendfach verkitscht, und ist doch als realer Schmerz nicht totzukriegen. Doch das Abwesende ist nicht nur ein allgegenwärtiger Punkt, um den das Begehren des Menschen kreist, es ist auch ein Motiv, ohne das die schmachtendste Kunstform überhaupt, die Popmusik, vielleicht nicht einmal existieren würde. “Absence makes the heart grow fonder” hieß es bei Dean Martin und unzähligen Nachfolgern, ins Negative gewendet brachten die Fehlfarben auf den Punkt: “Was ich kriegen kann gefällt mir nicht”.
Das Verlangen nach dem Abwesenden kommt auch in einem pathetisch-coolen Retro-Schmachtfetzen zu Wort, der dann auch gleich den Titel “Absence” trägt. Untermalt von unentrinnbar beschwörenden Akustikgitarren singt der Kopenhagener Kim Larsen von einer Abwesenheit, die das Herz entgegen dem englischen Sprichwort erkalten lässt, und erteilt einem absurden Begehren dennoch keine Absage. Es ist eine leidenschaftlich unterkühlte Tristesse, die der Song versprüht. Lässt man sich darauf ein, findet man sich wieder in einer Welt einsam Dahintreibender: ambivalenter Gestalten, wie sie sich ein Jim Jarmush oder ein Haruki Murakami ausgedacht haben könnte, aber ohne den Hoffnungsschimmer des surreal-andersweltlichen, mit dem letzterer so manchen Lichtstrahl in seine Romane dringen lässt. Ein offizieller Clip zu dem Song enthält nur Szenen aus Scorseses “Taxi Driver”, Aufnahmen aus einem einsamen und anonymen und doch bunten und Abenteuer versprechenden Großstadtkosmos. Man hofft auf ein Entrinnen, auf Ankommen, auf Sinn und Bedeutung, doch das Gefühl, in einer Zwickmühle gefangen zu sein, bleibt so konstant wie die Leere und die minimalen Akkorde der Gitarre, zwischen denen ganz versteckt eine vertrautere Welt, und mag sie verkitscht sein, durchscheint. Vielleicht findet sie sich auch im Namen des Projektes, mit dem Larsen schon seit Jahren unterwegs ist: Of The Wand And The Moon. Er klingt so gar nicht nach Kino und Bars und den Straßen der Metropole, sondern nach dunklen Wäldern, nach Zauber und Romantik und nach allem, was man mit dem Dark Folk-Genre assoziiert, in dem die Wurzeln dieser Musik zu finden sind.
Dass mir Larsens Folk immer etwas zu typisch ausgefallen war, mag mit ein Grund sein, dass ich seine Musik nur sporadisch wahrnahm und nie gezielt verfolgte. Trist waren seine Songs seit jeher, von einer Schwere, die frostig und sentimental zugleich war und den geneigten Hörer an einem dystopisch-eskapistischen Nicht-Ort zurückließ – lost in emptiness, wie es in einem Song hieß. In „The Lone Descent“, das mit seinem Akustiksound und der vertrauten Stimme immer noch ein reines Wand-Album ist, hat sich über Melodien und Intrumentierung ein leichtes Sixties-Feeling hineingeschlichen, die Songs sind teilweise beschwingter, aber auch cooler und unverblümter und Puristen sicher „zu modern“. Es wurde sogar schon hervorgehoben, Larsen klänge neuerdings viel mehr nach Lee Hazlewood als etwa nach jemandem wie Douglas P. – meinetwegen, aber mich zumindest erinnerte Pearce’ Gesang selbst auch schon immer an Hazlewood. Aber dass Larsen jetzt verstärkt singt, statt seine Texte zu sprechen oder zu flüstern, ist in der Tat kein unbedeutender Schritt. Für frischen Wind sorgt auch eine ganze Phalanx an Gästen, die an diversen Instrumenten aushelfen – vielleicht am prominentesten John Murphy am Schlagzeug, aber auch Musiker, die aus ganz unterschiedlichen Psychrock-, Jazz- und Folkgruppen stammen und dafür sorgen, dass der Sound offen bleibt und nicht allzu sehr in eine vorhersehbare Richtung drängt.
Meist prägt ein einzelnes Instrument den jeweiligen Song, z.B. Streicher, die den pathetischen Textvortrag in „Is It Out Of Your Hands?“ untermalen, oder das Akkordeon in dem gelösten Folksong „Sunspot“, das dem Titel entsprechend den hellsten Fleck darstellt auf dem ansonsten recht düsteren Album, bei dem ein Song mit dem Titel „Immer Vorwärts“ die Absurdität eines zielgerichteten Lebens verlacht – und betont, wie albern doch alles erscheint, wenn man die Vergänglichkeit bedenkt. Die drei Worte „We Are Dust“ scheinen ein treffendes Fazit zu sein – ein weiterer Titel, hinter dem sich eine Musik verbirgt, die entfernt an Changes, mit etwas Fantasie aber auch an Michael Gira erinnert.
Mich hat „The Lone Descent“ angenehm überrascht, aber das ist das subjektive Urteil eines vom klassischen Dark Folk seit langem übersättigten. Andererseits sollte man um den Wandel auch nicht zu viel Wind machen – immer wieder suchen Bands dieser Art ihre Wege aus der Monotonie, die dann meist durch Regionen wie Psychedelic, Americana, Cabaret oder Postpunk führen, ganz angesehen davon, dass das oft beschworene Phänomen Weiterentwicklung ohnehin selbstverständlich sein sollte: Immer vorwärts eben, wie ein Sisyphus, der seinen Stein gerne rollt. Wie könnte nun jemand „The Lone Descent“ beurteilen, der weder die Band noch ihre Geschichte kennt? Vielleicht als ein grundsolides, dunkles Popalbum.
Vertrieb: Tesco Distribution
