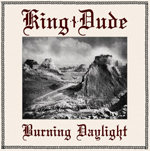 „We are King Dude“ wird man von TJ Cowgill neuerdings auf Konzerten begrüßt, was darauf schließen lässt, dass er und seine beiden Kumpanen mittlerweile so etwas wie eine feste Band bilden. Zeit also, vom Singular auf den Plural umzusatteln? Warum nicht. King Dude ist also ein Trio aus dem Nordwesten der USA, das dunkle, balladeske Räuberpistolen über die Liebe, den Teufel und den Whiskey zum besten gibt, untermalt von monoton beschwörenden Gitarren, in steter Bewegung gehalten von einer einfachen, evokativen Drumsection, die sich hier und da auch für martialische Trommelwirbel nicht zu fein ist – so könnte die Minimaldefinition für Neueinsteiger lauten.
„We are King Dude“ wird man von TJ Cowgill neuerdings auf Konzerten begrüßt, was darauf schließen lässt, dass er und seine beiden Kumpanen mittlerweile so etwas wie eine feste Band bilden. Zeit also, vom Singular auf den Plural umzusatteln? Warum nicht. King Dude ist also ein Trio aus dem Nordwesten der USA, das dunkle, balladeske Räuberpistolen über die Liebe, den Teufel und den Whiskey zum besten gibt, untermalt von monoton beschwörenden Gitarren, in steter Bewegung gehalten von einer einfachen, evokativen Drumsection, die sich hier und da auch für martialische Trommelwirbel nicht zu fein ist – so könnte die Minimaldefinition für Neueinsteiger lauten.
Innerhalb dieses Korsetts arbeiten King Dude mit einem klar umrissenen Repertoire an Stilmitteln, die griffig und mit festen Assoziationen belegt sind. Allem voran wäre da TJs markante Stimme, die – mal tief, mal rau, mal beides – sämtliche Register düsterer Sangeskunst zieht. Die beherrscht er übrigens auch ausgezeichnet, wenngleich all dies ebenso sehr ein gewollt aufgesetztes Spiel mit ollen Kamellen ist. Der Gedanke, dass neben den obligatorischen Tom Waits-Alben garantiert einige Cramps-Platten im Dude’schen Regal stehen, kommt einem nicht nur beim Gesang, denn die entspannten Surf-Twangs auf der neuerdings elektrischen Gitarre katapultieren den Hörer direkt in einen finsteren Gothic-Western – ein Genre, dass zumindest in einem Fall tatsächlich existiert. Während man dort mit einer verwegenen Halunkenbande durch die Wüste galoppiert, streift man Regionen, in denen seltsame Gewächse wie Altcountry, Texmex und eigenwillige Spielarten des Rock’nRoll gedeihen – eigenwillig schon allein wegen des seltsam ungoovigen Drummings, dass einem ins Gedächtnis ruft, dass das Ganze ursprünglich mal als eine Art Neofolk gehandelt wurde.
Zum Auftakt gibt es auf „Burning Daylight“ eine fiebrige Orgel, knisterndes Feuer und Alarmsirenen, wie um zu signalisieren, dass man hier kein braves Album in den Player gelegt hat. Manche finden, dass die Stimmung zwischen verlebter Leidenschaft und cooler Resignation weder Fleisch noch Fisch sei, und können entsprechend auch dem Stilmix aus Düsterfolk und 50s-Surfsound nur bedingt etwas abgewinnen. King Dude als Link Wray auf Benzos, als Zombi-Version von Chris Isaak, als der große, böse Bruder von Anna Calvi oder gar Lana del Rey? Meinetwegen. Meines Erachtens harmonieren aber alle Zutaten bestens, vielleicht weil die Musik meist dezent hintergründig bleibt, und der forcierte Bariton ohnehin den Eindruck erweckt, als würde man sich selbst nicht allzu ernst nehmen in der King Dude-Welt. Interessanterweise verleihen die steifen Folkelemente der Musik noch ein Stück mehr an coolem Zynismus.
Das von erschöpften Twangs wie von kranken Adrenalinstößen vorangetriebene „Holy Land“ klingt allem voran bedrohlich, und dem Text nach sollte man es sich gut überlegen, ob man sich in dem besungenen Revier als Eindringling erwischen lassen will. Cowgills Mitgliedschaft in einer Black/Death Metal-Combo nimmt man ihm doch eher ab, als sein hippes Fashion Label, und schon weil ich seine Vocals alles andere als gesetzt finde, mag ich auch nicht in den oft gezogenen Johnny Cash-Vergleich einstimmen – auch nicht beim Ein Akkord-Ohrwurm „Barbara Anne“, dass sich schnell als kein Beach Boys Cover entpuppt, und wie Henry Kissinger klingt beim Versuch, Scott Kelly zu imitieren. Die meisten Songs sind kurz und rasant und transportieren mit ihren Bad Guy- und Femme Fatale-Geschichten den Mythos eines interessanteren Amerika der düsteren Roadmovies, das amoralisch und unsentimental ist und vor Erotik knistert. „Detour“, der niederschmetternde Film Noir von Edgar Ulmer kommt mir spontan in den Sinn, oder vielleicht doch eher Tourneurs “Out of the Past” mit seinen etwas weniger deprimierenden Figuren.
Natürlich gehört zu all diesen Rockismen auch die obligatorische Ballade, und King Dude haben sich gleich das letzte Drittel des Albums dafür freigehalten. Von den getrageneren Stücken sticht v.a. „My Mother was the Moon“ heraus, bei dem keine Geringere als die derzeit beliebte Sängerin Chelsea Wolfe das Mikro überreicht bekommt. Der Song hat etwas von einem traurigen Schlaflied, jede Spur von Trash ist für Momente wie weggeblasen und ich musste an Nick Caves berührendes “My Daddy was an Astronaut” denken. Irgendwie passt auch das und wirkt kein bisschen deplaziert.
Mit „Burning Daylight“ haben King Dude bewiesen, dass sie keine Eintagsfliegen sind, und auch wenn das alles keine hehre Kunst ist, wünsche ich ihnen, dass man sie in Zukunft noch öfter zu hören bekommt. Ob im Bikerschuppen, auf dem spackigen Hipsterevent oder vorm stoisch-affektierten Szenepublikum in schwarz bleibt sich gleich.
Label: Dais Records
