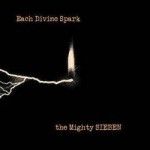 Matt Howden ist ein häufiger Gast auf unseren Seiten und überhaupt in fast allen Publikationen, deren Wurzeln irgendwo vage im postindustriellen oder folkigen Substrat der 90er stecken. Dass Howdens Musik mit solchen Sparten ästhetisch nur wenig zu tun hat, führt schon mitten hinein in die Besonderheiten seines Soloprojektes Sieben, das schon vor Jahren aus dem Schatten einer bekannten Dark Folk-Combo herausgewachsen und zu einem eigenen kleinen Kapitel alternativer Musikgeschichte avanciert ist. Sieben steht für einen sensiblen und zugleich kraftvollen Pop, der mit einfachen Mitteln eine bemerkenswerte atmosphärische Weite erzeugt und nicht nur durch Matts Gesang etwas sehr Englisches hat. Seine organischen Violinenklänge, in ihrem Wesen nie eskapistisch und stets weit über herkömmliche Streichertechniken hinausgehend, wirken fast wie guerilla gardening, wenn man sie vor dem Hintergrund seiner industriell geprägten Heimatstadt Sheffield betrachtet. So eingängig seine Songs sind, hätte Howden auf dem Höhepunkt des letzten Singer Songwriter-Hypes auf der Titelseite des Musikexpress landen können, wenn die richtigen Leute ihn „entdeckt“ und promoted hätten.
Matt Howden ist ein häufiger Gast auf unseren Seiten und überhaupt in fast allen Publikationen, deren Wurzeln irgendwo vage im postindustriellen oder folkigen Substrat der 90er stecken. Dass Howdens Musik mit solchen Sparten ästhetisch nur wenig zu tun hat, führt schon mitten hinein in die Besonderheiten seines Soloprojektes Sieben, das schon vor Jahren aus dem Schatten einer bekannten Dark Folk-Combo herausgewachsen und zu einem eigenen kleinen Kapitel alternativer Musikgeschichte avanciert ist. Sieben steht für einen sensiblen und zugleich kraftvollen Pop, der mit einfachen Mitteln eine bemerkenswerte atmosphärische Weite erzeugt und nicht nur durch Matts Gesang etwas sehr Englisches hat. Seine organischen Violinenklänge, in ihrem Wesen nie eskapistisch und stets weit über herkömmliche Streichertechniken hinausgehend, wirken fast wie guerilla gardening, wenn man sie vor dem Hintergrund seiner industriell geprägten Heimatstadt Sheffield betrachtet. So eingängig seine Songs sind, hätte Howden auf dem Höhepunkt des letzten Singer Songwriter-Hypes auf der Titelseite des Musikexpress landen können, wenn die richtigen Leute ihn „entdeckt“ und promoted hätten.
Repetition spielt bei Sieben nicht nur in Form von Loops, sondern auch werkgeschichtlich eine Rolle. Es gibt eine ganze Reihe an klanglichen, rhythmischen und gesanglichen Motiven, die sich wie ein roter Faden durch seine Alben ziehen und ein inneres Referenzsystem schaffen, das Arbeiten aus unterschiedlichen Zeiträumen miteinander verhakt. „Born from the Ashes“, der Opener seines aktuellen Longplayers, channelt musikalisch und lyrisch die Zeit seiner stilprägenden „Our Solitary Confinement“-LP und hält neben vertrauten Motiven bereits die wichtigsten Merkmale der aktuellen Schaffensphase bereit: Auf der einen Seite steht das geradlinige hand drumming, die melodischen Ornamente auf der Violine und der warme, leicht schwermütige Gesang, der manchmal wie ein missing link zwischen Dave Gahan und Morrissey anmutet. Dem gegenüber findet sich eine aufs Wesentliche reduzierte, fast dubbige Klanggestalt, bei der die einzelnen Spuren umso deutlicher im Vordergrund stehen. So wirken die Rhythmen beinahe wie anmontiert und die Geigensoli wie deutlich akzentuierte Streifen auf einer fast leeren Leinwand, und insgesamt erscheinen alle Motive in jener deutlichen, artifiziell anmutenden Klarheit, die Thomas Bernhard einmal so eindringlich mit dem Bild heller Köpfe in der Finsternis illustriert hat.
Dieser „Remix“-artige Zug findet sich in vielen der neuen Songs, vielleicht am deutlichsten in derangiert wirkenden Nummern wie „In this Place“, dessen exponierter Takt immer wieder leicht aus der Bahn gerät. Ebenso verspielt und ungleich ironischer geht es in „The National Anthem of Somewhere“ zu, dessen Text einen interessanten Verhaltenskodex herunterbetet. Zwischen holprigen Beats meint man hier das Echo einer ganzen Popgeschichte zu hören, und überhaupt scheint das Wiederaufgreifen, Zitieren und Channeln v.a. von sprachlichen Zeugnissen ein heimliches Thema des Albums zu sein, ebenso wie das brennende und numinose Funken sprühende Feuer, das der Sprachmagier damit zu entfachen weiß. „Palimpsest, Palimpsest…“ erklingt es fast im Flüsterton in einem Song, der bezeichnenderweise „Written in Fire“ heißt.
An keiner Stelle gerät „Each Divine Spark“ schwerfällig ob des vielfältigen Gehalts, der sich oft in den unscheinbarsten Nischen der Songtexte versteckt, und einige Stücke beiweisen einmal mehr Howdens Händchen für (je nach Songart anrührende oder mitreißende) Ohrwurm-Nummern. Auch das besinnliche „Sleep Clara Bow“, das mit vielen Auslassungen arbeitet und durch einen bei Sieben eher seltenen Klavierpart heraussticht, ist in diesem Sinne ein typischer Howden-Song. Entpuppen sich einige Stücke als etwas voluminöser, so geschieht dies nicht nur im Interesse der Abwechslung, sondern als bewusst maßgeschneiderte Klanggestalt für den jeweiligen Song. Dies gilt nicht nur für den lustigen Noise-Jux zum Ende des Albums oder für „Jigsaw Chainsaw“, das mit seinem verzerrten Geigen-Rocksound aus der Reihe fällt, sondern auch für den kleinen Hit „She is there“ – von einem euphorischen Beat vorangetriebenen, steigert sich der Song auch sonst in jeder Hinsicht, wird mit der Zeit voller und entpuppt sich als (fast schon zu schönes) Duett mit Howdens Tochter April, deren Part an anderen Stellen von Sarah Jay Hawley (ex-Massive Attack) übernommen wird. Dass selbst die schönsten Worte eine (intertextuelle) Vorgeschichte haben, kommt auch hier wieder zur Sprache. „She is there, in my voice“, ertönt es, und welche Zeile aus „Each Divine Spark“ würde mehr danach verlangen, zweistimmig gesungen zu werden?
Ich würde „Each Divine Spark“ ohne viel Brimborium als Howdens bisher ausgereiftestes, aber auch als ein in sich sehr stimmiges Album bezeichnen und empfehle es nicht nur seinen Fans, sondern auch denen, die irgendwann in den letzten Jahren eine Sieben-Pause eingelegt haben.
Label: Redroom
