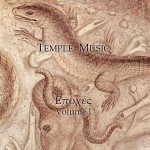 Temple Music, die rituell arbeitenden Psychedeliker aus der Nachbarschaft von Orchis, Howling Larsens und den Black Lesbian Fishermen, geben nicht einfach Konzerte an beliebigen Orten mit der Auswahl ihrer besten Stücke, sondern lassen den Ort und den Zeitpunkt selbst in die Rolle des Dirigenten schlüpfen, der den Musikern – in Form seiner Symbolik und seiner atmosphärischen Wirkung – die finale Struktur ihrer vorbereiteten Motive vorgibt. Der Ansatz, den Alan Trench, Steven Robinson und ihre jeweiligen Kollaborateure verfolgen, ist pragmatisch und zugleich magisch: Der Sound und die Resonanzen des Ortes bestimmen den Modus ihrer Darbietung, doch dies entspricht stets der Absicht des Einklangs mit dem genus loci. Eine Vielzahl empathischer Divinationsmethoden von Numerologie über Tarot und Runen bis zu den verschiedenen Kalendern des Christentums werden beansprucht, um auch dem kalendarischen Zeitpunkt zu entsprechen.
Temple Music, die rituell arbeitenden Psychedeliker aus der Nachbarschaft von Orchis, Howling Larsens und den Black Lesbian Fishermen, geben nicht einfach Konzerte an beliebigen Orten mit der Auswahl ihrer besten Stücke, sondern lassen den Ort und den Zeitpunkt selbst in die Rolle des Dirigenten schlüpfen, der den Musikern – in Form seiner Symbolik und seiner atmosphärischen Wirkung – die finale Struktur ihrer vorbereiteten Motive vorgibt. Der Ansatz, den Alan Trench, Steven Robinson und ihre jeweiligen Kollaborateure verfolgen, ist pragmatisch und zugleich magisch: Der Sound und die Resonanzen des Ortes bestimmen den Modus ihrer Darbietung, doch dies entspricht stets der Absicht des Einklangs mit dem genus loci. Eine Vielzahl empathischer Divinationsmethoden von Numerologie über Tarot und Runen bis zu den verschiedenen Kalendern des Christentums werden beansprucht, um auch dem kalendarischen Zeitpunkt zu entsprechen.
Was den Musikern dabei als selbsterarbeiteter Pool an variierbaren Sounds und musikalischen Motiven zugrunde liegt, ist meist skizzenhaft, vergleichbar den Standards beim Jazz. Die auf „Εποχές“ enthaltenen Stücke sind in eine narrative Struktur gebrachte Rekreationen dieses Materials, bzw. eine Auswahl dessen, was in vier den Jahreszeiten entsprechenden Aufführungen eingeflossen ist. Vier lange Tracks um die fünfundzwanzig Minuten kamen dabei heraus, die lediglich vom Nukleus der Band gespielt wurden und quasi dem Rumpf der jeweiligen Konzerte entsprechen. Die beiden ersten liegen nun vor.
„The Winter Queen…“, an dessen Umsetzung noch zwei weitere Musiker beteiligt waren, wurde im Dezember 2010 zusammen mit Eyeless in Gaza in Coventry aufgeführt, und wenn man sich die kreisenden Drones und die vielen unberechenbaren Details in angemessener Location vorstellt, entsteht zumindest die Ahnung der rituellen Atmosphäre, die an dem Abend kreiert worden sein muss. Auf der rekonstruierten Urfassung dominiert anfangs ein entspanntes, nicht zu engmaschiges Gitarrengewebe und verhalltes, ambientes Gleiten, das immer wieder von coolen Twangs aufgebrochen wird und mit der Zeit rauer und gröber wird. Man hat es hier mit einer Musik zu tun, von der man sich bei leichtem Phlegmatismus perfekt einlullen lassen kann, die aber bei entsprechender Aufmerksamkeit viele, oft nicht einmal nur unterschwellige Veränderungen zeitigt: Mal hat ein sanfter Gitarrenteppich die oberste Schicht für sich, dann wieder gibt sie Raum für allerhand Subkutanes, das sich wie Froschquaken oder wie perkussives Hantieren mit undefinierbarem Material anhört. Mal glaubt man, den Auftakt eines herkömmlichen Songs zu hören, doch dann übernehmen vorübergehend noisiges Feedbackrauschen und seltsam kratzige Schleifgeräusche das Feld.
Dass dies alles so wunderbar harmonisiert klingt und von der Sequenz her wie „natürlich“ gewachsen anmutet, gibt dem Track seine relaxte Stimmung, und es ist zugleich eine der Gemeinsamkeiten zum zweiten Stück, das am 15. Januar der Folgejahres in Gent den Frühling beschwor. „…and the Prince of Spring“ beginnt frickeliger und ergeht sich eine ganze Zeitlang in atmosphärischen Sounds, macht das Schmelzen von Eis hörbar, anheimelnd durchbrochen durch etwas, das an Vogeltrillern erinnert. Bei der ambienten Dröhnfläche, die sich bald abzeichnet, und erst recht bei der pastoralen Melodie, die nach Piano klingt, mag man das Stück als homogener empfinden, doch der unberechenbare Einsatz von Natursounds, Songfragmenten und Momenten der Dröhnung sind mit der Zeit immer mehr dagegen.
Doch so viel sich in den insgesamt fünfzig Minuten auch ereignet, bleibt doch alles zurückgenommen und subtil, und ich bin sicher, dass die kraftvolle, erdende Wirkung dieser Musik auch bei unachtsamem Hören nicht vollends ausbleibt. Auf den zweiten Teil bin ich gespannt. (U.S.)
Label: Sombre Soniks
