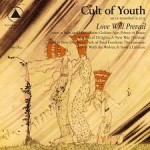 Es gibt Bands, deren Werk sich einem erst nach einer Livedarbietung erschließt, und in meinem Fall war das so bei Cult of Youth. Auf Platte hinterließ die Musik der New Yorker mit ihrer martialischen Steifheit und dem Gesang, der Ian Curtis anscheinend mit eigenen Mitteln überbieten soll und in gelegentliche Brüllattacken ausbricht, den paradoxen Eindruck eines rasenden Phlegmatismus. Jüngst habe ich erfahren, dass Cult of Youth einfach Spaß machen, denn auf der Bühne verwandeln sie sich in einen schweißtreibenden Oi-Mutanten und das kajalgeschminkte Publikum in einen pogenden Moshpit.
Es gibt Bands, deren Werk sich einem erst nach einer Livedarbietung erschließt, und in meinem Fall war das so bei Cult of Youth. Auf Platte hinterließ die Musik der New Yorker mit ihrer martialischen Steifheit und dem Gesang, der Ian Curtis anscheinend mit eigenen Mitteln überbieten soll und in gelegentliche Brüllattacken ausbricht, den paradoxen Eindruck eines rasenden Phlegmatismus. Jüngst habe ich erfahren, dass Cult of Youth einfach Spaß machen, denn auf der Bühne verwandeln sie sich in einen schweißtreibenden Oi-Mutanten und das kajalgeschminkte Publikum in einen pogenden Moshpit.
Spricht man von Cult of Youth, kommt man an der berüchtigten Frage nach Einflüssen und Querbezügen nicht vorbei, denn ihr Stil ist nun mal – ob man ihn mag oder nicht – ein großes Mosaik an Referenzen. Vor allem englische Combos der 80er klingen an, zwei Kapellen, die sich in ihrer besten Zeit sicher nicht riechen konnten, bieten die größten Vergleichsmomente: Cult Of Youth erinnern zum Teil recht stark an frühe New Model Army, bloß ohne die friedensbewegte Attitüde zwischen Batik und Birkenstock. Ebenso – paradoxerweise – an Death in June, bloß akustischer als das frühe, fetziger als das mittlere und frischer als das aktuelle Werk des Alt-Punks aus Fort Nada. Das sind nur zwei besonders augenfällige Beispiele, aber was die New Yorker von diesen und wohl allen anderen häufig genannten Referenzgruppen unterscheidet, ist eine markige, unverquaste Working Class-Art, eine Street Credibility, die so manches Idol als feinen Pinkel erscheinen lässt, ungeachtet ob man diesem nun musikalisch das Wasser reichen kann oder nicht. Ihr eigenes Terrain eines Oi-Neofolk teilen sie sich bislang nur mit den etwas lascheren australischen Lakes. Auf den Alben kommt das leider nur halb so gut zur Geltung und das Schlagzeug rumpelt längst nicht so sehr wie auf Konzerten, wo es wie ein mit zwei Hämmern malträtierter Pappkarton klingt – zugunsten filigraner Soundschnipsel, die hier und da einen Song einleiten wie zum Beispiel „Man and Man’s Ruin“, den Opener des aktuellen Albums. Hier erinnern nicht nur diese Geräusche an apokalytischen UK-Folk, sondern auch die monotonen Akkorde und die Fanfare sprechen eine klare Sprache: Nicht einverstanden mit dem was statt hat, rebelliert man, ohne zu moralisieren und sich verlogen bunten Hoffnungen hinzugeben, bleibt kühl, aber nicht beherrscht, bloß skeptisch und gibt sich ein bisschen reaktionär. „Golden Age“ ist schon poppiger, eine im Grunde graue, aber dennoch schmissige englische Herbstmusik, die an eine Band wie die Housemartins denken lässt. Selbst der amerikanische Akzent hält sich, vielleicht dem Nordosten geschuldet, in Grenzen und ist eine Art Gegenstück zum „mid atlantic accent“ englischer Sixties-Sternchen, die das Britische stilvoll mit einem amerikanischen „r“ versahen, wie es später nur noch Rose McDowall hinbekam.
Doch genug des Namedroppings, zumal Cult Of Youth sich mit der Zeit wirklich zu behaupten wissen mit einer eigenen Charakteristik, die sich stark aus der Diskrepanz zwischen aggressivem Postpunk und martialischer Kälte speist. Ist dies erst einmal richtig angekommen, hat sogar amerikanische Lässigkeit ihre kurzen Momente. „Prince of Peace“, die ironische Beschwörung eines Messias, ist ein Hauch von Texmex beigemischt, „A New Way“ ist vielleicht das amerikanischste Stück: Piano, Doomjazz u.s.w., bis gewohntes Parolengröhlen die typische Cult Of Youth-Stimmung zurückbringt.
Um nochmal auf Neofolk zurück zu kommen: Ich tu mich mit dieser Verortung im Grunde schwer, weil sie vorschnell ist und den vielfältigen Bezügen nicht gerecht wird, dennoch spielen die New Yorker eine Musik, die frischen Wind in diese untote Szene bringen könnte. Als vor Jahren „richtiger Folk“ in war, hatte er viel von dem, was die Darkfolker immer für sich beanspruchten: Schrägheit, Exzentrik, Tradition, skurrile Nostalgie ohne Idyll. Dennoch gab es selten Berührungen, denn dem Weird-Folk und vergleichbarem fehlte einfach das Verhaftetsein in bürgerlichen Strukturen, um vom etwas strengeren großen Bruder wahrgenommen zu werden. Erst die Wave 2.0-Phänomene ein halbes Jahrzehnt später, die vor rund zwei Jahren mit Witchhouse sämtliche Ecken der hippen Subkulturen erreichten, konnten auch diesem ein paar frische Zellen verabreichen. Neben King Dude, dem Tarantino des Neofolk, sind vor allem Cult Of Youth zu nennen, die sicher auch das Zeug haben, ihr “Klingt wie dies, klingt wie das”-Image abzustreifen.
Label: Sacred Bones
